Na sowas:
Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen stimmt uns offenbar zu, was „Rituelle Gewalt“ angeht – scheint das aber gar nicht zu merken.
Wie zahlreiche andere Medien berichtet auch die Süddeutsche Zeitung über das Gutachten des Bistums Münster:

Dabei zitiert die Autorin Annette Zoch die Bundesmissbrauchsbeauftragte Kerstin Claus mit einer Stellungnahme. Erwartungsgemäß beanstandet Claus die umfangreiche Analyse der Kanzlei Feigen · Graf – verhaspelt und widerspricht sich dabei aber an einem entscheidenden Punkt selbst:
Die Unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, kritisierte auf Anfrage der SZ die enge Definition von „ritueller Gewalt“ in der Studie: Diese unterscheide sich „deutlich von dem, was ich und mein Amt unter ritueller Gewalt verstehen“: Diese gebe es durchaus, wenn religiöse Ideologie zur Rechtfertigung von Gewalt diene.
Rituelle Elemente seien Teile von Täterstrategien, stellten aber keinen eigenständigen Tatkontext dar. „Allein, dass rituelle Elemente Teil von sexualisierter Gewalt waren, darf nicht dazu führen, die Berichte Betroffener grundsätzlich deswegen infrage zu stellen.“
Aha.
Wenn aber „rituelle Elemente“ lediglich „Teile von Täterstrategien“ sind, jedoch keinen „eigenständigen Tatkontext“ darstellen – was soll dann überhaupt der eigenständige Begriff „Rituelle Gewalt“ mit 20 verschiedenen Definitionen?
Und was die „religiöse Ideologie“ angeht:
Dass Manipulationsstrategien von Sexualstraftäter:innen keine „rituelle Gewalt“ sind, hat die Psychologin Jasmina Eifert hier in unserem Blogpost ausführlich erklärt. Wenn etwa ein Kinder missbrauchender Priester seinen Opfern mit der Hölle und dem „Teufel höchstpersönlich“ droht, ist das eine Geheimnissicherungsstrategie, um die Opfer zum Schweigen zu verpflichten, ebenso wie Sätze à la „Das bleibt unter uns. Das ist etwas ganz Besonderes. Gott würde es billigen“ oder „Gott sieht das gern“.
Die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) nennt als Charakteristikum „für ideologisch begründete (rituelle) Gewalt, dass die Täter:innen die Betroffenen beeinflussen und einen angeblichen weltanschaulichen oder religiös geprägten Sinn der Gewalt vermitteln“.
Tatsächlich aber sind das nichts anderes als gezielte Angstschürungen mit religiösem Autoritarismus, vergleichbar mit strategischen Lenkungen in familiären Kontexten, wie zum Beispiel „Wenn das Kind über den Missbrauch sprechen würde, käme Unglück über alle, müssten die Kinder ins Heim, die Mutter würde krank, der Vater käme ins Gefängnis, die Familie zerbreche und so weiter“. Nichts davon hat irgendetwas mit einer „religiösen Ideologie“ zu tun, sondern es handelt sich um in der Psychologie und Kriminalistik längst bekannte Vorgehensweisen von Missbrauchstäter:innen.
Das scheint auch Kerstin Claus zu wissen, wenn sie also sagt:
Rituelle Elemente seien Teile von Täterstrategien, stellten aber keinen eigenständigen Tatkontext dar.
Dann aber ist „Rituelle Gewalt“ als eigenständiger Begriff vollkommen obsolet – sondern es handelt sich praktisch in allen Fällen um sexualisierte Gewalt ohne rituelle Handlungen oder ideologischen Überbau. Dass das auch für sexuellen Missbrauch in Sekten gilt, wie etwa der Colonia Dignidad, haben wir ebenfalls hier ausgeführt. Natürlich bauen viele Kultgruppen „Systeme und Strukturen auf, in denen Personen benutzt oder ausgenutzt werden“. Sexualstraftaten resultieren aber auch dort aus den bekannten Motiven heraus, wie Macht, sexuelle oder finanzielle Interessen, wie etwa bei „Go&Change“.
Also warum führt die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung auf ihrer Webseite eine eigene Definition speziell für „Rituelle Gewalt“ auf, offenbar wider besseres Wissen? So wie auch die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (UKASK) stets von „organisierter und ritueller sexualisierter Gewalt“ spricht, und auch die Regisseurin Liz Wieskerstrauch ihrem Streifen „Blinder Fleck“ den Untertitel „Ein Dokumentarfilm über Rituelle Gewalt“ verpasst hat – obwohl es um nichts anderes geht als um sexualisierte Gewalt mit vergleichbaren Geheimnissicherungsstrategien wie in anderen Zusammenhängen?
Wir können darüber nur spekulieren. Die Kriminologin Petra Hasselmann sagte dazu:
Rituelle Gewalt klingt mysteriös, unglaublich, unbegreifbar. Und bedient „das Unbegreifbare“ am Ende nicht das, was Menschen dazu animiert, Horrorfilme, Serien wie „Game of Thrones“ oder den sonntäglichen „Tatort“ zu schauen?
Oder dazu animiert, für ein Filmprojekt wie „Blinder Fleck“ zu spenden, möchte man hinzufügen. Oder Aufmerksamkeit generiert.
Hasselmann weiter:
Denn eigentlich braucht man einen solchen Begriff ja gar nicht, wenn mögliche Tathandlungen bei einer Einzelfallbetrachtung durch bereits bestehende Straftatbestände klar umschrieben, weil definiert sind.
Er ist aber mitsamt seinen impliziten Assoziationen wichtig für die ideologisch geführte Debatte, um dem Gewaltformat einen Charakter von Wahrheit und realer Existenz zu verleihen.
Aber nicht nur Kerstin Claus stößt an ihre argumentativen Grenzen, wenn es um den Münsteraner Untersuchungsbericht geht. Dem Nachrichtenportal katholisch.de zufolge kritisiert der Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) die in der Studie angewandten aussagepsychologischen Untersuchungen. Diese seien zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen psychisch gesunder Personen konzipiert.
„Gerade bei Betroffenen sexualisierter Gewalt ist die Anwendung problematisch, da sie häufig an posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. Aussagepsychologische Verfahren berücksichtigen diese Traumafolgen nicht ausreichend.“
Psychische Erkrankungen würden in solchen Gutachten oft als Hinweis auf eingeschränkte Glaubwürdigkeit interpretiert. Daher lehne der Betroffenenbeirat diese Praxis ab.
Vielleicht sollte sich der Betroffenenbeirat eingehender mit der Methode der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung beschäftigen, anstatt sie als Angriff aufzufassen, zum Beispiel hier:
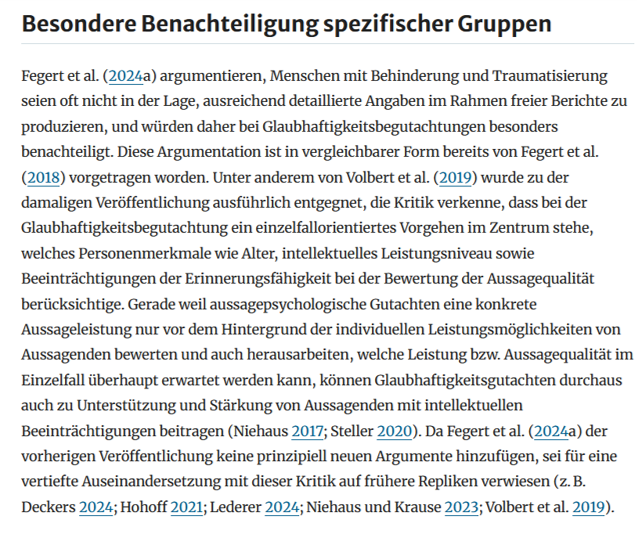
Auch die Gutachterin Silvia Gubi-Kelm weist Kritik an der Begutachtungsmethodik zurück.
Dass das Gutachten nicht beweisen könne, dass es keine Täternetzwerke in der katholischen Kirche gebe – geschenkt, eine Nichtexistenz kann man nicht beweisen. Zumal die Gutachter betonen (Seite 5):
Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche ist ein reales Phänomen.
Vielmehr ist die Frage (Seite 79), ob „Alltäglichkeiten als Bestätigung für die Machenschaften der Täternetzwerke ausgelegt“ werden können, wie beispielsweise herausgelassene Luft aus einem Fahrradreifen.
Wohl eher nicht. Aber eine ernsthafte, selbstkritische Beschäftigung seitens der Betroffenenbeiräte, Politiker, Aktivisten etc. mit dem Münsteraner Untersuchungsbericht war auch nicht wirklich zu erwarten.
Zum Weiterlesen:
- Harder, Bernd „Bloß eine Scheinerklärung: Bistum Münster untersuchte ein Dutzend Fälle ritueller Gewalt“ skeptix (9. Oktober 2025)
- Zoch, Annette „Gab es Netzwerke ritueller Gewalt?“ Süddeutsche (10. Oktober 2025)
- Harder, Bernd „Rituelle Gewalt-Mind Control: Die vielen blinden Flecke des Dokumentarfilms Blinder Fleck“ skeptix (13. Juni 2025)
- Volbert, Renate et al. „Die aussagepsychologische Begutachtung: eine verengte Perspektive?“ Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie (20. März 2019)
- „Definitionen Rituelle Gewalt“ Infoportal Satanic Panic (15. August 2025)
Titelfoto: Freepik/Wirestock


Schreibe einen Kommentar